Inzens - die Weihrauchstraße in den Himmel
17. Andere Düfte und andere Räume
Die odoratische Dimension ist nicht nur auf Weihrauch und duftendes Salböl einzugrenzen. Ein weites Feld von etwa 150 ätherischen Ölen und ca. 3000 synthetischen Duftstoffen ist zu überschauen, und diese lassen wiederum Milliarden von Kombinationsmöglichkeiten zu!
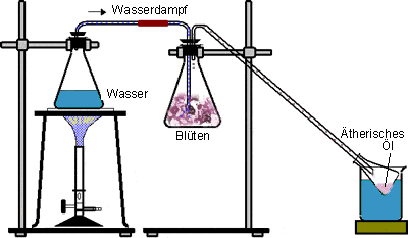
Gewinnung ätherischer Öle
Man schätzt, dass unsere Nase immerhin 10.000 verschiedene Duftnuancen unterscheiden kann. Die Vielfalt der Düfte kann z.B. bei "Gottesdiensten im Grünen" eine Rolle spielen.
Befragungen in Deutschland und Japan ergaben eine besonders positive Bewertung von Naturgerüchen, mit denen durchweg gute Erfahrungen verbunden werden. Es scheint eine im Menschen tief verankerte Vorliebe für Pflanzen zu geben.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass das im profanen Bereich übliche Ausstreuen von Blumen und die sog. Potpourries bisweilen Einzug in den Kirchenraum hielten. Manchenorts gab es (auch unabhängig vom Hochzeitsbrauchtum) die Sitte, die Kirchen mit Blumen auszustreuen, woran folgende Standpauke erinnert:
"Du schlimmer Bengel, wärst du heut' nicht so spät, läg meines Fräuleins Kirchstuhl längst schon übersäet mit süßen Primeln, Schlüsselblumen und Violen..."
Und wer weiß schon noch, dass in den Kirchen echter Waldmeister aufgehängt wurde, dessen liebliches Aroma an eine Mischung von Heu, Honig und Vanille erinnert.
Oft haben kirchliche Räume einen unverkennbaren Geruch, der sich, auch wenn er nicht bewusst wahrgenommen wird, auf den Gottesdienst auswirkt, unter Umständen kontraproduktiv: Riecht es -
- schimmlig, muffig und abgestanden
- oder frisch nach Weite oder anregend geheimnisvoll
- oder steril nach Kunststoff und Reinigungsmitteln
- oder hängt penetrant schwerer Weihrauch im Raum, der einem die Luft zum Atmen nimmt
- oder ist die samstägliche Feier im multifunktionalen Gemeindezentrum am Sonntag morgen noch zu riechen?
Kirchenbauten sind, auch nach aufwendigen Renovierungen, in der Regel schlecht zu lüften. Klappfenster sind entweder schwer gängig oder die Klappen schließen nicht. Warum ist das so? Es zeigt jedenfalls, dass die Notwendigkeit frischer Durchlüftung - zumindest im Raum von Kirche - noch kaum gesehen wird.
Als man in den 80er Jahren anfing, über Phänomene wie das Sick-Building-Syndrom zu reden, begannen Architekten sich verstärkt mit der Luftqualität im Innern zu beschäftigen, und zwar nicht allein mit CO2-Werten, sondern auch mit den Ausdünstungen, wie sie von Menschen und Materialien ausgehen.
Die Herangehensweise an das Problem war typisch westlich-technisch: Man entwickelte Messmethoden, legte Einheiten (olf, decipol) und Grenzwerte fest. Inzwischen haben es sich Firmen zur Aufgabe gemacht, große Räume mit Hilfe von Aromastreamern oder über die Klimaanlagen zu beduften - und sie haben einen interessierten Markt gefunden.
"Das professionelle Herstellen einer olfaktorischen Behaglichkeit setzt ... neben komplexen, ausgewogenen Duftstrukturen voraus, dass diese in einer gleichmäßigen Konzentration in einen Luftstrom abgegeben werden und ständig nur knapp oberhalb der Wahrnehmungsschwelle gehalten werden.
Sie dürfen also nicht von den Menschen als Duft bemerkt werden, sondern sollen nur das unbestimmte Gefühl hervorrufen, sich wohlzufühlen, verbunden mit dem Wunsch, in dem Raum verweilen zu wollen."
Diese Selbstaussage einer mit Beduftung von Räumen befassten Unternehmerin, macht die Zielsetzung dieser Technik deutlich, vor allem aber deren manipulative Problematik in einer Zeit, in der immer mehr "öffentliche" Räume Interessen privater Besitzer dienen. Solche Beduftung ist denn auch keineswegs unumstritten:
"Ebenso, wie eine Dauerberieselung mit Musik schon zur Gewohnheit geworden ist und kaum noch in Frage steht, wird hier ein weiteres Stück individuellen Freiraumes - von den meisten unbemerkt - vom Markt der Dufthersteller zerstört." (Margit Kennedy)
Zu bedenken ist auch, dass jeder neue chemische Reiz in unserer reizüberfluteten Umwelt vor allem angesichts wachsender allergischer Reaktionen und Atemwegserkrankungen eine weitere Belastung darstellt.
Andererseits spielen, was Geruchsbelastungen angeht, auch mentale Faktoren eine Rolle. Die ökologische Diskussion hat hier zu einer Übersensibilisierung geführt, in der geruchsintensive Fremdstoffe völlig undifferenziert als Schadstoffe erlebt werden.
In Bezug auf diesen mentalen Aspekt der Geruchsempfindlichkeit kann ängstliche Zurückhaltung nicht prinzipiell die adäquate Reaktion sein.

Chinesisches Räuchergefäß
Bruno Bettelheim hat sich mit dem Geruch in Kliniken befasst, in denen seiner Meinung nach entweder ein schlechter, muffiger, oftmals kalter Geruch herrscht oder aber ein antiseptischer, also der am wenigsten menschliche.
Da solche stillen Geruchsbotschaften keine neutralen Informationen, sondern Träger überaus starker Intentionen sind, ist es nicht verwunderlich, wenn manche Menschen erst vollständig genesen können, nachdem sie die Klinik verlassen haben.
Bettelheim zeigt aber auch die Schwierigkeiten, auf rein chemisch - mechanischem Wege eine sympathische Geruchswelt zu erzeugen, wenn er feststellt:
"Der Geruch eines Ortes ist ein subtiler, durch Wände, Stoffe, Möbel und so weiter vermittelter Eindruck des Wohlbefindens oder Unbehagens seiner Bewohner; und nur Individuen, die sich in ihrer Haut wohl fühlen, können den erwünschten, beruhigenden Geruch verströmen."
[ zurück zu "Rituale" | Übersicht | weiter ]
