Inzens - die Weihrauchstraße in den Himmel
5. Gesellschaftliche Beachtung des Geruchssinns
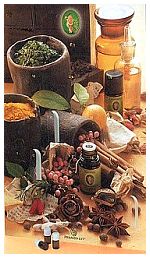
Welt der Düfte
In einer Zeit, in der die kulturelle Entwicklung eine Komplexität erreicht hat, unter der der gesamtgesellschaftliche Diskurs zerbrochen ist, hilft es wenig, dem Volk immer nur auf´s Maul zu schauen.
Es könnte bisweilen aufschlussreicher sein, zu gucken, was es sonst so treibt. Vielleicht sind es ja ganz andere "Sprachen", die inzwischen sozialregulativ wirken. Und da scheint - unter anderem - die Welt der Düfte durchaus eine Rolle zu spielen.
Obwohl westliche Menschen Gerüche noch immer relativ undifferenziert wahrnehmen, hat sich in den letzten Jahrzehnten ein großes Interesse an Parfums und Duftstoffen entwickelt, das sich in verschiedenen Ausprägungen auf dem Markt abzeichnet:
- Entwicklung des persönlichen Dufts: Die Drogisten- und Parfumeriebranche boomt; der Jahresumsatz 1994 betrug allein bei den Pariser Parfumhäusern 56 Milliarden Francs.
- Duftkultur im privaten Wohnraum wächst: Räucherstäbchen, Duftlampen, Raumduftsprays, Lavendelsäckchen als eleganter und duftendes Zedernholz als ökologischer Mottenschutz, Duftaufhänger im Auto, Aromatherapie ...
- Manipulationsversuche im öffentlichen Raum der Wirtschaft, wo man versucht, unbewusste Wirkungen zu nutzen: Duftverströmer in Geschäften, Restaurants und Praxen; odorierte Plakate; Gebrauchtwagen werden zum Verkauf mit Neuwagen-Duft ausgesprüht ...
Es dürfte kein Zufall sein, dass der Geruchssinn wieder zum Thema wird in einer Zeit, in der sich die Struktur der Informationsverarbeitung zu ändern beginnt.
Das Schlagwort von der "neuen Unübersichtlichkeit", mit dem sich die Postmoderne selbst zu charakterisieren versucht, legt eine Rückbesinnung auf jenen Sinn nahe, der einmal zur Orientierung in einer unübersichtlichen Welt diente.
Tatsächlich gilt z.B. als Managerqualität heute nicht mehr so sehr Weitsicht, als die instinktnahe Intuition. Statt soliden Fünfjahresplänen muss man in der Risikogesellschaft eher den "richtigen Riecher" haben, um zu ahnen, wo es jetzt weitergeht.
Zugleich - als Gegen- oder Parallelbewegung - sammeln sich neu-humanistische Bemühungen unter dem diffusen Symbol des "Holismus". Unscharfe Begriffe wie "Atmosphäre" werden gerade wegen ihrer integrativen Offenheit interessant.
Von beiden Seiten (Differenzierung und Ganzheitlichkeit) wird eine Wahrnehmungshaltung gefordert, die nicht mehr an der gedanklichen Reihung sprachlich orientierter Logik festhält, sondern vielmehr jene synchrone Komplexität besitzt, die den geruchlichen Sinneseindrücken nicht unähnlich ist.
Atmosphärisches spielt gerade in der Religion eine größere Rolle, als unsere Schultheologie sich manchmal träumen lässt. Warum z.B. haben die Dokumente theologischer Annäherung, die im Zeitalter der Ökumene entstanden sind, in der konfessionellen Praxis so wenig Folgen?
Sie werden von den meisten Christen nicht einmal wahrgenommen, solange sie blutleeres Papier bleiben und sich nicht im sinnlich Wahrnehmbaren auswirken.
An der Basis findet man weithin noch immer jene seltsame Ablehnung der anderen Konfession, die zwar nicht mehr aggressiv ausagiert wird, aber emotional so verwurzelt ist, dass sie von vernunftgeleiteter Argumentation weitgehend unberührt bleibt.
Mit intuitiver Sicherheit erfassen selbst kirchenferne Protestanten, wenn etwas irgendwie katholisch "riecht". Und da reformatorisches Selbstbewusstsein meist mit einer Art kollektiver Traumatisierung verbunden ist, wird - nach dem bekannten Mechanismus feindbildorientierter Identität ("Evangelisch ist, was nicht katholisch ist") - auf das Katholische mit Ablehnung reagiert.
Es mag paradox klingen, aber in der Kirche des Wortes scheint sich derzeit nonverbal mehr bewegen zu lassen als durch Worte. Auf der Fährte des Weihrauchs werden wir verstehen lernen, warum.
[ zurück zu "Rituale" | Übersicht | weiter ]
