Inzens - die Weihrauchstraße in den Himmel
6. Gerüche als Schlüssel zur Kindheit
"Der denkende Mensch erlebt es immer wieder schmerzlich, dass ihm gerade sein Denken die Unmittelbarkeit des Erlebens und Empfindens zerstört und dass ihn sein Wahrnehmen unerbittlich von den Objekten seiner Wahrnehmung trennt.
In unseren Geruchsempfindungen jedoch, in den Erfahrungen dieses archaisch gebliebenen Sinnes, lebt die Unmittelbarkeit des Erlebens und das Gefühl der Einheit mit dem Wahrgenommenen weiter. Geruchserinnerungen sind der magische Teppich, der uns in einem Augenblick in die paradiesisch unreflektierte Welt der Kindheit zurückträgt." (Stefan Jellinek)
Gerüche gelten als ein "Schlüssel zur Kindheit". Im Bild des "Schlüssels" ist angedeutet, dass gespeicherte Erfahrungen nicht immer zugänglich sind, oft aber durch bestimmte "Speichersignale" freigesetzt werden können.

Alter Schulkorridor
Gerüche eignen sich durch ihre Emotionalität offenbar besonders gut, Hinweise auf frühere Situationen zu geben, die einen hohen biographischen Bedeutungswert haben. Ein solches "Speichersignal" kann z.B. der übersüße Apfelduft sein, der uns an den Keller des Elternhauses erinnert, oder der Wachsgeruch eines Treppenhauses, der uns sofort mit Assoziationen aus unserer Schulzeit überschwemmt.
Es kann auch im späteren Leben Ereignisse geben, deren komplexe Gefühlswelt sich an einen bestimmten Geruch haftet: ein Desinfektionsmittel etwa, das Erinnerungen an eine schwere Operation wachruft.
Der Geruchssinn wäre evolutionshemmend und somit ein negatives Selektionsmerkmal, wenn er nur konservativen Charakter hätte. Tatsächlich aber sind Duftstoffe auch an der Löschung bestehender Prägungen und somit bei der Anpassung an sich wandelnde Lebensumstände beteiligt. Ein Beispiel:
"Im Riechkolben eines kreißenden Schafs wird Oxytocin freigesetzt, was zu veränderten Reaktionen auf Geruchsreize führt. Daran sieht man, dass das Riechen an den Prozessen des Verlernens beteiligt ist, die eine Umgewöhnung des Muttertiers an neue Jungtiere in aufeinanderfolgenden Schwangerschaften ermöglicht." (Walter Freeman)
Vergleichbare Vorgänge gibt es durchaus auch im menschlichen Sozialverhalten: Wenn im Zuge der Pubertät mit etwa 14 Jahren die Produktion der Sexualpheromone einsetzt, ändert sich mit der geruchlichen Atmosphäre auch die emotionale Disposition gegenüber den Eltern in Richtung auf Eigenständigkeit und Konkurrenz. Von nun an gewinnen - neben dem Duft der Sexualpartner - auch andere überfamiliäre Gruppengerüche für die Orientierung an Bedeutung.
Im Zuge ihrer kulturellen Entwicklung hat die Menschheit gelernt, Duftstoffe einzusetzen, um bestehende Trennungen aufzuheben und gezielt neue Gruppen-Identitäten zu bilden. Besonders deutlich zeigt sich diese sozialstiftende Wirkung am Phänomen des Rauchens:
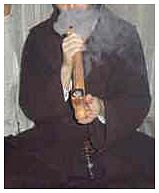
Friedenspfeiferauchender
Franziskanermönch
Von den Pfeifen-Ritualen der Buschmänner in Botswana oder der nordamerikanischen Ogalalla-Sioux bis hin zum gegenwärtigen Tabakkonsum erweist sich Rauchen immer wieder als ein kontaktanknüpfender Akt.
Selbst die gegenwärtigen Nichtraucherkampagnen, deren Militanz der beste Beweis für die Affektivität des Riechens ist, bestätigen die sozialregulative Relevanz der Gerüche:
Dadurch dass in Zügen, Flugzeugen, Restaurants und neuerdings auch an anderen Orten Raucher- und Nichtraucherzonen eingerichtet werden, wird die Gesellschaft zunehmend in eine neue Art von "Konfessionen" gegliedert.
[ zurück zu "Rituale" | Übersicht | weiter ]
