Das Kirchenjahr
Aufsatz: Symphonie der Zeit - 1
- Rhythmus
- Melodie
- Polyphonie
- Dur und Moll
Das Kirchenjahr ist eine gewaltige Komposition, die die biblischen Geschichten mit den wiederkehrenden Himmelbewegungen von Sonne und Mond verbindet, die einstimmt in die Klima- und Vegetationszyklen der Natur und sie mit den biologischen Rhythmen der Menschen in Einklang bringt. Allerdings nehmen wir diese große "Partitur" selten als Ganze wahr. Uns begegnen die einzelnen Feste meist nur wie verstreute Töne; ihr harmonischer Zusammenklang bleibt dabei verborgen.
Rhythmus
"Beim nächsten Ton ist es: 8 Uhr, 52 Minuten und 20 Sekunden - Fiep!" Solche Zeitansagen sind für uns selbstverständlich geworden. Und doch drückt sich in ihnen ein Zeitkonzept aus, das - mit der fortschreitenden Entwicklung der Uhren - erst allmählich entstanden ist: Zeit als ein aus der Zukunft in die Vergangenheit gleichmäßig abfließender Strom, der sich unterteilen läßt in Jahre, Tage, Stunden und Sekunden.
Noch jede tausendstel Sekunde ist genau definiert, und alle sind gleich. Keine Zeiteinheit ist gegenüber den anderen herausgehoben. Keine hat eine besondere Stimmung. Stunde ist Stunde.
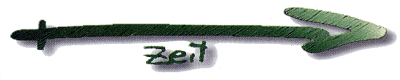
Lineare Vorstellung ...
Mit solch einer berechenbaren Zeitvorstellung läßt sich gut arbeiten. Aber kann man damit auch leben? - Für unser menschliches Empfinden ist Zeit keineswegs immer ein Strom. Es gibt bestimmte regelmäßig wiederkehrende Ereignisse, die uns eher ein kreis- oder spiralförmiges Bild der Zeit vor Augen stellen.

... oder Zeit als Spirale
wiederkehrender Ereignisse?
Wie erleben wir Zeit?
Alles Leben verläuft in Rhythmen. Auch die Cäsium-Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, die den Takt aller Uhren vorgibt, mißt die Zeit auf der Basis rhythmischer Schwingungen.
Interessant für uns als Menschen sind aber v.a. solche Rhythmen, die wir unmittelbar wahrnehmen können und die uns von daher als natürliche Zeitmarken dienen: "Nach dem Abendessen geh ich immer noch mal mit dem Hund raus."
Die rhythmischen Gewohnheiten, die unseren Alltag strukturieren, legen wir zum Teil selbst fest; zum Teil folgt unser Leben aber auch übergeordneten Gesetzmäßigkeiten: Vor allem der Wechsel von Nacht und Tag, hervorgerufen durch die Eigendrehung der Erde, regelt unsere Ruhe-, Arbeits- und Essenszeiten.
Phänomene wie Jetlag oder die typischen Krankheitsbilder von Schichtarbeitern zeigen, daß sich der menschliche Bio-Rhythmus nicht ohne weiteres von dem großen, natürlichen Tageszyklus abkoppeln läßt.
Ein anderer wichtiger Rhythmus ist der Jahreskreis, der uns durch den Wechsel der Jahreszeiten erfahrbar wird. Beim jährlichen Umlauf der Erde um die Sonne verändert sich - aufgrund der Neigung der Erdachse - langsam aber stetig die Dauer der Sonneneinstrahlung auf den jeweiligen Beobachtungsstandpunkt.
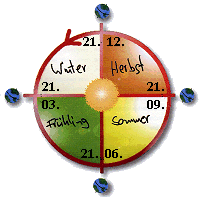
Die Einteilung der Jahreszeiten
orientiert sich am
Verhältnis von Sonne und Erde.
Die Veränderung in der Intensität von Licht und Wärme beeinflußt das Klima und bringt - zumindest in unseren Breiten - vier ausgeprägt unterschiedliche Vegetationsphasen hervor. Die Einteilung des Jahres in Frühling, Sommer, Herbst und Winter beruht also letztlich auf astronomischen Gesetzmäßigkeiten: Anhand des Sonnenstands lassen sich jene vier markanten Zeitpunkte ermitteln, die jeweils den Beginn eines neuen Quartals markieren.
Spätestens seit dem 4. Jahrhundert haben die Christen begonnen, die natürlichen Signaturen der Zeit bewußt in die kirchlichen Lebensordnungen einzubeziehen. Man wollte im Einklang leben mit der gottgegebenen Schöpfungsordnung, deren Zeitmaße sich an den Bewegungen der Himmelskörper ablesen ließen.
In den Klöstern begannen Mönche, zu festen Zeiten ihre "Stundengebete" zu singen, deren Texte atmosphärisch auf die jeweilige Tageszeit abgestimmt sind.
Und für jedermann mitvollziehbar, bildete sich ein kirchlicher Festkalender aus, in dem sich die Zyklen der natürlichen Jahreskreises mit den geistigen Inhalten des Christentums zu einer organischen und tiefsinnigen Einheit verbanden.
