Die Geschichte der Klosterkirche Lippoldsberg
14. Die Ittersche Turmknaufchronik und das Ende des Klosters
Mit dem Jahr 1437 setzt der Bericht einer neuen Quelle ein. Wohl verwahrt im Turmknauf ~das ist dieser runde, glänzende Gnubbel auf der Kirchturmspitze~ befindet sich die Chronik des Amtsvogtes Conrad Itter, die er 1722 verfasst hat und die bis auf das Jahr 1437 zurückreicht. So sind wir wohlunterrichtet über Hochwasserstände der Weser, trockene Sommer und später über die Übergriffe der in den 30-jährigen Krieg involvierten Truppen.
Doch zu den wichtigsten Ereignissen dieser Jahrhunderte zählt sicherlich der Einzug der Reformation ins Hessische. Am 11. März 1538 führte Phillipp von Hessen den reformierten Glauben in Hessen ein. Und doch erfolgten keine der erwarteten drakonischen Maßnahmen gegen die Klöster und ihre Insassen.
Für das Kloster Lippoldsberg entschied man sich gegen eine Zwangsvertreibung und teilte den Besitz zwischen den darum konkurrierenden Landesherren wie folgt auf. Die Güter des Klosters gingen an die Braunschweiger, das Kloster und das Dorf verblieben unter der Hoheit des hessischen Grafen.
Mit dieser Aufteilung begann Lippoldsbergs Zukunft als Dorf an einer Landesgrenze: sprachlich und kulturell sicherlich eher den Niedersachsen verbunden, aber unter der Gerichtsbarkeit des Landes Hessen stehend. Das Aussterben des Klosters Lippoldsberg ging langsam vor sich.
In den vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts erfolgte ein Aufnahmestop der Novizinnen, 1563 wurde der Besitz des Klosters inventarisiert und 1564 der erste protestantische Pfarrer in sein Amt als Pfarrer von Lippoldsberg eingeführt. Die nun mehr evangelische Gemeinde und das Kloster teilten sich die Kirche bis 1569 mit der letzten Äbtissin Lutrudis von Boyneburg, mit der die Nonnen in Lippoldsberg ausstarben.
Die Klosterkirche ging zur " ewigen Nutzung" in die Hände der evangelischen Gemeinde über. Die Bevölkerung leistete ihre Abgaben nunmehr an den Landesfürsten.
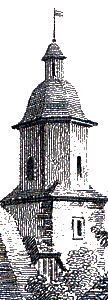
Lippoldsberg
Barocke Turmhaube
Wie bereits erwähnt folgen dann in der Itterschen Turmknaufchronik die Schilderung der Schäden die der 30-jährige Krieg in Lippoldsberg und den umliegenden Gefilden verursachte. So wird beispielsweise 1664 der Turm der Klosterkirche, in den sich die Bevölkerung geflüchtet hatte, beschossen und die Wendeltreppe mit Hilfe von Strohballen angezündet.
Der Schaden an der Kirche hielt sich in Grenzen und erst 1667 wurde der Turm erneuert. 1682 wurde die gotische Innenbemalung der Kirche neugeschaffen und der ungenutzte Westflügel des Klostergebäudes wurde 1713 vom Landgrafen Karl in ein Jagdschloss umgebaut.
Es war wiederum eine Folge der Reformation, die 1722 in das Leben der Bevölkerung in und um Lippoldsberg eingriff. Dreißig hugenottische Familien aus dem Piemont wurden vom Landgrafen in zwei neugegründete Dörfer auf der anderen Uferseite angesiedelt. Es entstanden Gewissenruh und Gottstreu. Im selben Jahr, und so endet die Ittersche Chronik, erhielt der Turm der Klosterkirche die barocke Haube, die er heute noch trägt. Zu diesem Zeitpunkt umfasste Lippoldsberg 123 Familien und 94 Wohnhäuser.
Es die Natur einer solchen Chronik, dass sie nur die Höhepunkte und Schrecken einer Zeitspanne schildert, über den Alltag erfahren wir so gut wie nichts. Und doch stellt sich ein gewisses Gefühl der Verbundenheit ein, wenn geschildert wird, welche Bedeutung als Fluchtpunkt oder als Aufbewahrungsort der kostbaren Chronik der Turm der Klosterkirche, der noch heute das Dorf überragt, damals für die Menschen besaß.
[ Zurück zur Übersicht | weiter ]
