Interaktiver Hörführer
Station 6 - Text & Bild zum Hörführer
Vor der Südseite,
wo etwas über die Bautechnik gesagt wird
[ Übersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

Wenn Sie vor diesem 850 Jahre alten Großbau stehen, der in knapp 10 Jahren ausgeführt worden ist, wobei - nach grober Schätzung - etwa 10.000 Tonnen Material verbaut wurden, fragen Sie sich vielleicht: Wie haben die das damals gemacht?
Eins ist sicher: Die Nonnen haben diese Kirche nicht gebaut. Ihr Leben in der Klausur ließ nur häusliche Handarbeiten zu. Aber um das Kloster herum hatte sich eine kleine Gemeinschaft gesammelt: einige Geistliche, die das gottesdienstliche Leben aufrecht hielten, und auch Laienbrüder, die die Arbeit in Hof und Feld verrichteten. Sie alle werden nach ihren Kräften an dem Kirchbau mitgewirkt haben.
Allen voran Propst Gunther, der in dieser Zeit dem Kloster als geistlicher Vater vorstand und der auch die äußeren Geschäfte leitete. Gunther von Halberstadt war ein Mönch aus dem Kloster Hamersleben. Er war ein begabter Mann, der viel herumgekommen war und geistig auf der Höhe seiner Zeit stand.
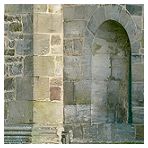
Als ihn der Mainzer Erzbischof zum Propst von Lippoldsberg ernannte, hatte Gunther überhaupt keine Lust, diesem Ruf in einen so entlegenen Winkel zu folgen. Es bedurfte der Vermittlung durch Papst Innozenz II, dem es bei einem persönlichen Gespräch in Rom gelang, Gunther zur Übernahme des neuen Amtes zu bewegen. Vielleicht spielten ja bei den Verhandlungen auch Zusagen über finanzielle Mittel für den Kirchenbau eine Rolle.
Jedenfalls muß Gunther bald nach seiner Ankunft in Lippoldsberg 1139 mit den Bauplanungen begonnen haben. Gunther wird als der maßgebliche Architekt der Klosterkirche angesehen. Aber ihm stand natürlich der erfahrene Meister einer Bauhütte zur Seite. Und all die professionellen Handwerker, die zu einer Bauhütte gehörten: Steinbrecher, Steinmetze, Bildhauer, Maurer, Zimmerleute, Schmiede usw. Zu ihnen gesellten sich die klostereigenen Hilfskräfte.
Ein großes Problem war die Materialversorgung der Baustelle. Der rotbraune Sandstein, der den größten Teil des Mauerwerks ausmacht, wurde in kleinen Steinkuhlen in der unmittelbaren Umgebung von Lippoldsberg abgebaut. Zum Teil wurden wohl auch einfach Steine auf dem Feld aufgelesen.

Besondere Werksteine, die Sockel z.B. oder die sauber gearbeiteten Eckquader, bestehen aus grauem Trendelburger Sandstein. Und die Fensterlaibungen sind zum Teil aus Karlshafener Sandstein gefertigt. Diese Steine mußten also über größere Entfernungen herbeigeschafft werden, wobei neben einfachen Fuhrwerken auch Kähne zur Verfügung standen. Auf der Baustelle selbst wurden die Steine dann mit Rollen und Kränen, teilweise durch Treträder angetrieben, in die Höhe gehievt.
Besondere Steine, z.B. die Eckquader, wurden von den Steinmetzen nicht nur bearbeitet, sondern auch selbst gesetzt. Das wichtigste Steinmetzwerkzeug war der Zweispitz, auf der einen Seite ein Pickel, auf der anderen ein Beil. Schmiede mußten diese Werkzeuge täglich schärfen und härten.
Die nur grob behauenen Mauersteine wurden von Maurern gesetzt. Und zwar wurden jeweils zwei Wände dicht nebeneinander hochgezogen, damit außen und zum Innenraum der Kirche hin jeweils eine glatte Wandfläche entstand.

Zwischen die beiden Mauerschalen verfüllte man ein Gemisch von Steinabfall und Kalkmörtel. Dieses Füllmaterial mußte in Kübeln über Leitern und Gerüste nach oben gebracht werden.
Während die Innenwände verputzt wurden und ursprünglich auch bildreich ausgemalt waren, ist das Bauwerks außen wohl nie verputzt gewesen.
Abgesehen von den Sandsteinplatten, die seit 1827 die Dachziegel ersetzen, zeigt das Gebäude im Außenbereich also noch sein 850 Jahre altes Gesicht.
Sie sind am Ende des Weges angekommen.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir Ihnen mit den Informationen einen inneren Zugang zu Klosterkirche erschließen konnten.
Die Kirchengemeinde wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.

